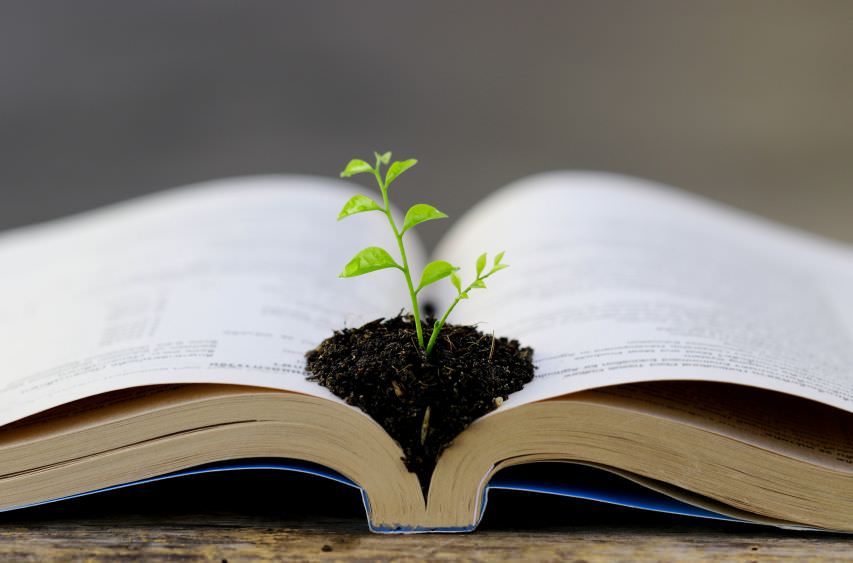Wann fand in der Vergangenheit welches Ereignis statt? Rückblicke sind immer interessant und auch im Bereich der Pflanzengeschichte gibt es vieles zu erzählen. Von Exporten über neue Entdeckungen bis hin zum Ausbau von bestehenden und bewährten Systemen – auch im 4. Jahrhundert haben wir wieder viele geschichtliche Ereignisse für Sie zusammengetragen.
300 – 310 nach Christus
- 300: Im heutigen Tunesien (früher: Proconsularis) liegt eine der wichtigsten Getreidekammern des Römischen Reiches. Ab dem Beginn des 4. Jahrhunderts wird die Produktion intensiviert, um die wachsende Bevölkerung Roms und Konstantinopels versorgen zu können.
- 303: In der ägyptischen Stadt Hermopolis werden neue Kanäle angelegt, damit die Nilflut besser zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen genutzt werden kann. Dadurch wird zusätzlich der Export von Weizen nach Rom unterstützt.
- 305: In Palästina, Syrien und Zypern belegen Funde von Amphoren die sich immer weiter ausbreitenden regionalen Weinsorten. Genannt werden die Behälter „Gaza-Amphoren“, die für die damalige Zeit typische Exportbehälter für Wein darstellen.
- 307: Aus Baetica in Südspanien wird Olivenöl in großen Mengen über Flüsse wie die Rhone nach Norden verschifft. Die Funde von Dressel-20-Amphoren in Gallien datieren genau diese Zeit.
- 309: In der Poebene im nördlichen Italien entstehen vermehrt römische Gutshöre, die sich auf den Obstanbau spezialisieren. Hier werden vor allem Feigen, Kirschen und Pfirsiche angebaut.
311 – 320 nach Christus
- 311: In Armenien wird das Christentum offiziell eingeführt. In Klöstern werden zunehmend systematisch Nutzpflanzen wie Getreide, Trauben und Heilkräuter kultiviert, was einen großen Einfluss auf die regionale Agrarstruktur hat.
- 315: In Südgallien (heute: Provence) werden Gutshöfe ausgebaut, um sich zukünftig auf exportfähige Produkte wie Olivenöl, Wein und Trockenobst zu spezialisieren.
- 317: Achäobotanische Untersuchungen zeigen, dass sich ab 317 kultivierte Kernobstsorten in der Rheinebene ausbreiten – begünstigt vermutlich durch lokale Märkte und römische Gutshöfe.
- 319: Zur Sicherung der sogenannten „annona“, der staatlichen Getreideversorgung, erlässt die Verwaltung in Karthago Vorschriften zur Lagerung und Kontrolle von Getreidemengen auf Landgütern.
- 320: Neue archäologische Funde zeigen, dass in und um das syrische Apameia gezielt Kanäle und Terrassenanlagen gebaut werden, um Feigen, Wein und Dattelpalmen zu kultivieren.
321 – 330 nach Christus
- 321: Der römische Kaiser Konstantin der Große erlässt ein Gesetz, welches bestimmte städtische Bevölkerungsgruppen verpflichtet, dauerhaft an ein Gut gebunden zu bleiben. Das fördert die Stabilität der landwirtschaftlichen Produktion, aber auch die spätrömische Leibeigenschaft.
- 325: Beim ersten Konzil von Nicäa werden Regeln zur Verwendung von Öl (in den meisten Fällen Olivenöl) für Salbungen und für Lampenlicht im kirchlichen Kontext festgelegt. Dadurch wird die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Öl deutlich erhöht.
- 327: Zwischen dem Euphratgebiet und Palmyra in Syrien gelegene Karawanenwege werden wieder stärker genutzt, um Datteln, Myrrhe und Gewürze aus dem persischen Raum ins Römische Reich zu bringen.
- 329: Kaiser Konstantin erlässt eine Steuerreform, die zur Abgabe von Naturalien verpflichtet. Betroffen davon sind vor allem Getreide, Wein und Olivenöl, wodurch eine stärkere Erfassung der Agrarproduktion stattfindet.
- 330: Konstantinopel wird Hauptresidenz des Römischen Kaisers Konstantin und somit zur neuen Hauptstadt. Dadurch entsteht ein strategisch wichtiger Verteilerhafen für Getreide aus Ägypten und für Fischsauce, Wein und Öl aus Kleinasien.
331 – 340 nach Christus
- 331: Nach der Gründung Konstantinopels werden entlang des Goldenen Horns große Speicherhäuser für Getreide aus Ägypten errichtet. Grund ist das schnelle Wachstum der Metropole – man will dadurch Versorgungsengpässe verhindern.
- 333: Ein christlicher Pilger aus Gallien dokumentiert Weinberge in der Nähe von Jerusalem und beschreibt die Qualität des dort produzierten Weins – ein deutlicher Hinweis auf den florierenden lokalen Weinbau.
- 337: Der römische Kaiser Konstantin stirbt. Dadurch wird das Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt, was dazu führt, dass regionale Verwerfungen entstehen, wie etwa im Transport von ägyptischem Getreide, das zwischen Ost- und Westreich umverteilt wird.
- 338: Papyrusdokumente zeigen, dass Flachsanbau zur Herstellung von Leinen zunimmt. Teilweise geschieht dies unter kirchlicher Aufsicht, aber auch zur Produktion liturgischer Gewänder.
- 339: Große Bischofssitze richten in Nordafrika eigene Speicher für landwirtschaftliche Erzeugnisse ein, um dadurch den Armen Hilfe zukommen zu lassen – dies ist unter anderem für Karthago und Hippo Regius belegt.
341 – 350 nach Christus
- 341: Ein Erlass aus der Verwaltung Ägyptens verpflichtet Landbesitzer zur Meldung ihrer Jahreserträge und legt Mindestmengen für den Abtransport nach Konstantinopel fest.
- 345: Der Safrananbau in Kleinasien wird ausgeweitet – er wird als Gewürz und als Farbstoff genutzt. Literarische Hinweise aber auch Pollennachweise aus Lykien belegen dies.
- 347: In Norditalien wird eine neue Einfuhrsteuer auf Wein fällig. Eine Gesetzesreform führt zu dieser neuen Abgabe auf importierten Wein, was verstärkt den lokalen Weinanbau in der Poebene ankurbelt.
- 348: Knochenfunde und botanische Daten zeigen, dass kultivierte Pflaumenarten erstmals systematisch in Dardanien und Moesien (westlicher Balkan) verbreitet werden.
- 350: Unter Kaiser Constantius II. wird die Naturalsteuer in vielen Provinzen verschärft. Dabei müssen auch Kleinpächter festgelegte Mengen an Getreide, Öl und Wein abliefern.
351 – 360 nach Christus
- 351: Die Kastanie wird immer öfter als Nahrungsmittel und Holzlieferant kultiviert – besonders in den hügeligen Regionen von Ligurien und in der Poebene.
- 352: Die erste Erwähnung christlicher Weinberge in Aquileia (Norditalien) findet statt. Eine lokale Kirchengemeinde verfügt laut einer Inschrift über eigene Weinberge – ein Hinweis auf den zunehmenden christlichen Einfluss im Weinbau.
- 355: In Ägypten findet die sogenannte „Bucolische Revolte“ statt. Sie wurde durch die Frustration über Naturalabgaben der Bauern ausgelöst. Große Landeigner und städtische Eliten haben zuvor zahlreiche Privilegien, zu Lasten kleiner Bauern, erhalten.
- 358: Kirchliche Chroniken berichten über Missernten und Nahrungsmittelknappheit in großen Teilen des Nahen Ostens. Grund dafür sind Dürrejahre, die durch eine klimatisch bedingte Trockenperiode ausgelöst wird.
- 360: Die griechische Hafenstadt Thessaloniki beginnt mit dem Bau eines neuen Speicherhauses zur Aufnahme von Getreide und Olivenöl, das aus Makedonien und Thrakien stammt. Ein Zeichen dafür, dass der Osthandel immer mehr floriert.
361 – 370 nach Christus
- 361: Kaiser Julian, auch „der Abtrünnige“ genannt, erlässt während seiner kurzen Regierungszeit Maßnahmen zur Förderung traditioneller Heilkräuter, darunter Salbei, Fenchel und Myrrhe, unter anderem für Tempelzwecke.
- 363: Der Persienfeldzug findet statt. Dabei setzt die römische Armee mobile Vorrichtungen zur Verarbeitung von Getreide ein. Gefunden wurden bei archäologischen Ausgrabungen Hinweise auf tragbare Mühlen.
- 367: Der Weinanbau am Rhein ist gesichert belegt. Am Vicus von Ladenburg werden römische Weinpressanlagen ausgegraben, die auf eine florierende, regionale Weinproduktion zur Versorgung von Militär und Städten hinweisen.
- 369: Als Militärverwalter organisiert Theodosius (Vater des späteren Kaisers) die Getreide- und Fleischversorgung für Grenztruppen, die entlang der Donau stationiert sind und lässt dabei verfallene Gutshöfe reaktivieren.
- 370: Funde, die in Carnuntum und Brigetio (heute: Österreich und Ungarn) gemacht werden, zeigen, dass die Walnuss nicht nur wild, sondern systematisch in Gutshöfen kultiviert wird. Sie wird als Nahrungs- und Ölpflanze verwendet.
371 – 380 nach Christus
- 373: Chroniken aus Alexandria berichten von einer deutlich zu schwachen Nilflut. Die Folge: Es werden Ernten ruiniert und Hungersnöte brechen aus. Gleichzeitig wird der Getreideexport nach Konstantinopel drastisch reduziert.
- 375: Die Hunnen dringen über die Wolga nach Westen vor. Dabei werden große Umsiedlungswellen in Gang gesetzt, wodurch Regionen, in denen die Agrarwirtschaft eins florierte, destabilisiert werden. Dies betrifft vor allem Regionen an der unteren Donau und in Dakien.
- 376: Nach ihrer Aufnahme ins Reich wurden die Goten in Thrakien angesiedelt und dazu verpflichtet, Land zu bestellen und gleichzeitig Naturalabgaben zu leisten.
- 378: Funde bei Mérida in Spanien belegen die Kultivierung neuer Weizensorten und Variationen von Oliven. Eingeführt werden diese vermutlich aus Afrika oder dem östlichen Mittelmeerraum.
- 379: Der römische Kaiser Theodosius I. reorganisiert das Versorgungssystem in Konstantinopel. Dabei werden Zwischenlager und Mühlenketten modernisiert.
381 – 390 nach Christus
- 383: Funde bei Tarsus (Türkei) zeigen, dass Ölmühlen mit christlichen Symbolen zur lokalen Versorgung von Gemeinden dienten – darunter Armenküchen und Spitäler.
- 384: Der römische Senator Quintus Aurelius Symmachus fordert die Rückgabe eines Siegesaltars samt Getreideopfern. Dies zeigt den symbolischen Wert von landwirtschaftlichen Produkten in der Religionspolitik.
- 386: In Nordafrika werden Hohlspindelmühlen eingeführt – dies belegen archäologische Funde aus Lepcis Magna und Sabratha. Die Funde zeigen die technische Weiterentwicklung der Getreidemühlen mit höherem Ertrag.
- 388: Mit der stärkeren Anbindung Armeniens an das Römische Reich gelangen Sorten von Aprikosen, Granatäpfeln und Walnüssen über Handelswege immer öfter nach Kappadokien und Syrien.
- 390: In Ephesos wird eine regionale Naturalsteuer auf Honig eingeführt. Bienenhaltung ist im kleinasiatischen Raum weit verbreitet – die Steuer wird auf Honig und Wachs festgesetzt, um die Kosten für Kerzen für Kirchen und Klöster zu decken.
391 – 399 nach Christus
- 391: Das Verbot heidnischer Kulthandlungen betrifft auch landwirtschaftliche Rituale. Dabei wird das rituelle Opfer von Getreide, Tieren und Wein auf ländlichen Gütern verboten. Das Gesetz, das Theodosius I. einführt, verändert die agrarisch-religiösen Praktiken grundlegend.
- 393: Durch die Aufgabe öffentlicher Badeanstalten in ländlichen Städten wird der Ölverbrauch gemindert. Die Thermen werden aufgrund von wirtschaftlichen Rückgängen und politischer Instabilität aufgegeben.
- 396: In Palästina werden erstmals Pilgergärten erwähnt. Die Gärten befinden sich in Klöstern, die Kräuter, Feigen, Wein und Öl für Pilger bereitstellen – ein frühes Beispiel agrartouristischer Infrastruktur.
- 398: Der Kirchenlehrer Augustinus von Hippo berichtet in Briefen über einen Konflikt um Landverkäufe zugunsten kirchlicher Güter in Nordafrika. Das zeigt, wie aktiv die Kirchen in die Agrarstruktur eingriffen.
- 399: Mit der Verschlechterung der römischen Kontrolle in Britannien brechen überregionale Handelsstrukturen zusammen. Besonders betroffen davon ist der Weizenexport an den gallischen Markt.